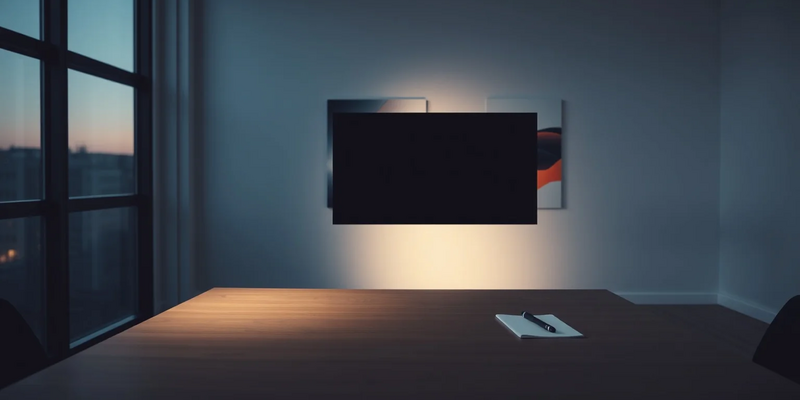KI im Personalwesen: Deutsche Mitarbeiter wollen – Unternehmen zögern
19.11.2025 - 23:03:12Eine aktuelle Studienwelle offenbart ein bemerkenswertes Paradox: Deutsche Arbeitnehmer blicken neugierig und optimistisch auf Künstliche Intelligenz, doch in den Unternehmen kommt die Technologie kaum zum Einsatz. Massive Qualifikationslücken und fehlende Unterstützung durch Führungskräfte bremsen die Transformation, obwohl das wirtschaftliche Potenzial enorm ist. Die neuesten Daten von PwC und Slalom zeichnen das Bild einer Branche am Scheideweg.
49 Prozent der Beschäftigten begegnen KI mit Neugier, 26 Prozent sogar mit Vorfreude – so das Ergebnis der am 17. November veröffentlichten PwC-Studie „Global Workforce Hopes and Fears 2025″. Diese positive Grundstimmung könnte kaum stärker kontrastieren mit der Realität am Arbeitsplatz. Weniger als die Hälfte der Mitarbeiter hat im vergangenen Jahr überhaupt mit KI gearbeitet. Nur 9 Prozent nutzen generative KI täglich.
Was bremst den Fortschritt? Laut PwC sind es nicht fehlende Technologien, sondern mangelnde Kompetenzen, unklare Anwendungsfälle und zu wenig Rückendeckung durch das Management. Dabei sprechen die Zahlen eine klare Sprache: 65 Prozent der KI-Nutzer berichten von verbesserter Arbeitsqualität, 62 Prozent konnten ihre Produktivität steigern. Ein enormes Potenzial liegt brach.
Viele Unternehmen unterschätzen die Anforderungen der EU-KI-Verordnung: Kennzeichnungspflichten, Risikoklassifizierung und umfangreiche Dokumentations‑ und Nachweispflichten erschweren die schnelle Einführung von KI-Lösungen. Unser kostenloser Umsetzungsleitfaden erklärt in klaren Schritten, welche Pflichten jetzt gelten, welche Fristen anstehen und wie Sie Ihre Projekte rechtssicher aufsetzen — inklusive praktischer Checkliste für Entwickler und Anwender. Jetzt kostenlosen KI-Umsetzungsleitfaden herunterladen
Jobwandel statt Jobverlust
Die Befürchtung massiver Arbeitsplatzverluste durch KI erweist sich als unbegründet. Deutschland steht vielmehr vor einem tiefgreifenden strukturellen Wandel. Eine heute veröffentlichte Analyse auf Basis von Forschungsdaten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) prognostiziert bis 2040 eine Umverteilung von rund 1,6 Millionen Stellen. Die Gesamtzahl der Arbeitsplätze bleibt jedoch stabil.
Diese Prognose wird durch aktuelle Zahlen des Technologieberatungsunternehmens Slalom bestätigt. Bereits 73 Prozent der deutschen Unternehmen schaffen neue Rollen oder ganze Teams mit KI-Fokus. Gleichzeitig reduzieren 59 Prozent ihre Neueinstellungen in anderen Bereichen – eine deutliche Verschiebung der Prioritäten. Der Trend geht zum „KI-unterstützten Supermitarbeiter”, der Technologie für Analyse, Problemlösung und strategische Intelligenz nutzt.
Die Qualifikationslücke als Haupthindernis
Was ist die größte Bremse für den KI-Erfolg? 55 Prozent der Unternehmen nennen laut Slalom-Studie fehlende Fachkräfte und mangelnde interne Kompetenzen. Die Verantwortung liegt beim mittleren Management – doch dort zeigen sich erhebliche Defizite. Nur 42 Prozent der Manager fühlen sich derzeit in der Lage, ihre Teams effektiv im Umgang mit KI zu coachen.
Zwar setzen 59 Prozent der Unternehmen auf interne Datenanalysen und 57 Prozent auf strategische Personalplanung, um den künftigen Qualifikationsbedarf zu ermitteln. Doch nur 32 Prozent nutzen fortschrittliche KI-gesteuerte Prognose-Tools. Experten sind sich einig: Ohne massive Investitionen in Weiterbildung wird die Transformation scheitern.
Regulierung als zusätzliche Hürde
Die Zurückhaltung vieler deutscher Unternehmen hat auch regulatorische Gründe. Der EU AI Act stuft zahlreiche Anwendungen im Personalwesen – etwa im Recruiting oder bei der Leistungsbewertung – als Hochrisiko-KI ein. Die Folge: strenge Dokumentations-, Transparenz- und Aufsichtspflichten, die eine sorgfältige und oft langwierige Implementierung erfordern.
Hinzu kommt die betriebliche Mitbestimmung. Der Betriebsrat hat bei Systemen, die potenziell Leistung und Verhalten von Mitarbeitern überwachen können, ein starkes Mitspracherecht. Dies führt zu längeren Abstimmungsprozessen, sichert aber gleichzeitig faire und transparente KI-Anwendungen im Einklang mit Arbeitnehmerrechten.
4,5 Billionen Euro Potenzial bis 2040
Die Zahlen sind beeindruckend: Die IAB-Analyse prognostiziert ein zusätzliches Wertschöpfungsplus von 4,5 Billionen Euro bis 2040 allein durch KI. Um dieses Potenzial zu heben, müssen Führungskräfte jetzt handeln. Gefragt sind eine klare strategische Vision und eine Unternehmenskultur, die Neugier und Experimentierfreude fördert.
Konkret bedeutet dies: gezielte Investitionen in die Weiterbildung der Belegschaft und die notwendigen Ressourcen für Manager, um ihre Teams an neue KI-Anwendungsfälle heranzuführen. Der Wettlauf hat längst begonnen. Die Gewinner werden jene Unternehmen sein, die den Wandel von einer reaktiven Haltung zu einer proaktiven Gestaltung der KI-gestützten Arbeitswelt vollziehen.
PS: Zeitdruck droht — viele Übergangsfristen der KI-Verordnung laufen jetzt ab und Unternehmen riskieren Bußgelder, wenn sie Anforderungen wie Transparenznachweise oder Risikobewertungen nicht erfüllen. Der gratis Download liefert eine pragmatische Roadmap zur Einordnung Ihrer Systeme, konkrete To‑dos für Verantwortliche und Vorlagen für die benötigte Dokumentation. Ideal für Manager, Datenschutzbeauftragte und Entwickler, die KI sicher nutzen wollen. KI-Verordnung-Roadmap jetzt kostenlos sichern