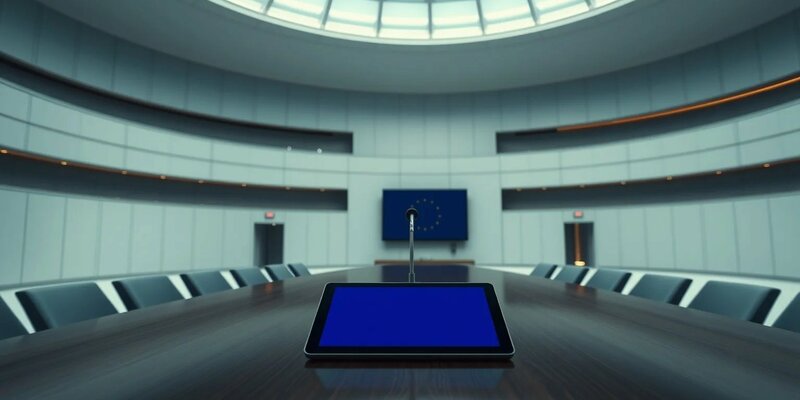Europa gegen US-Tech: Berlin fordert digitale Unabhängigkeit
22.11.2025 - 17:09:11Die Zeiten, in denen Europa stillschweigend amerikanische Cloud-Dienste und KI-Systeme übernahm, sind vorbei. Diese Woche trafen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Berlin, um eine klare Botschaft zu senden: Europa will endlich eigene digitale Champions aufbauen – und zwar jetzt.
Der „Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität” auf dem EUREF-Campus markiert einen Wendepunkt. Während die EU-Kommission zeitgleich Untersuchungen gegen Amazon Web Services und Microsoft Azure einleitet, wächst der politische Wille, die Abhängigkeit von US-Konzernen zu durchbrechen. Doch kann das funktionieren?
Am 18. November versammelten sich über 1.000 Gäste im Berliner Gasometer – darunter Digitalminister aus 23 EU-Staaten. Im Zentrum stand eine gemeinsame deutsch-französische Erklärung, die Europas digitale Infrastruktur grundlegend stärken soll.
Digitalminister Dr. Karsten Wildberger machte deutlich, worum es geht: „Wir Europäer können und wollen bei den Schlüsseltechnologien zu den Führenden gehören. Die Ära des passiven Konsums ausländischer Technologie ist vorbei.” Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam den Takt vorgeben.
Trotz aktueller Debatten um eine regulatorische Pause gilt die EU-KI-Verordnung bereits – und viele Unternehmen wissen nicht, welche Pflichten jetzt gelten. Unser kostenloser Umsetzungsleitfaden fasst Kennzeichnungspflichten, Risikoklassifizierung und notwendige Dokumentationsschritte kompakt zusammen, damit Sie Bußgelder und Implementationsfallen vermeiden. Ideal für Entwickler, Anbieter und Entscheider in Europa. Damit schaffen Sie Rechtssicherheit und planen Übergangsfristen gezielt. Kostenlosen KI-Verordnungs-Leitfaden herunterladen
Die Strategie konzentriert sich auf „europäische Präferenz” bei öffentlichen Ausschreibungen – besonders in kritischen Bereichen wie Cloud-Computing, Dateninfrastruktur und künstlicher Intelligenz. Ein direkter Angriff auf die Dominanz der US-„Hyperscaler” AWS, Microsoft und Google, die derzeit rund zwei Drittel des europäischen Cloud-Markts kontrollieren.
Für Merz und Macron ist dies keine reine Wirtschaftsfrage. Sie rahmen digitale Souveränität als Sicherheitsimperativ: Wer die Daten kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Angesichts wachsender geopolitischer Spannungen ein Argument, das Gewicht hat.
Brüssel schlägt zu: DMA-Ermittlungen gegen AWS und Azure
Während in Berlin geredet wurde, handelte Brüssel. Am Dienstag kündigte EU-Kommissions-Vizepräsidentin Henna Virkkunen formelle Marktuntersuchungen gegen Amazon Web Services und Microsoft Azure an – auf Grundlage des Digital Markets Act (DMA).
Die Ermittlungen sollen klären, ob diese Cloud-Dienste als „Gatekeeper” eingestuft werden müssen. Eine solche Einstufung würde sie zu strikten Interoperabilitäts- und Fairness-Regeln verpflichten. Bemerkenswert: Die Kommission startet die Untersuchungen, obwohl AWS und Azure die quantitativen Nutzerschwellen des DMA formal nicht erreichen.
„Cloud-Computing-Dienste sind entscheidend für Europas Wettbewerbsfähigkeit”, erklärte Virkkunen. „Wir wollen, dass dieser strategische Sektor unter fairen, offenen und wettbewerbsfähigen Bedingungen wächst.” Die aggressive Haltung deutet auf Besorgnis hin: Brüssel fürchtet, dass europäische Unternehmen in restriktiven Ökosystemen gefangen werden.
Falls die Einstufung erfolgt, hätten AWS und Microsoft sechs Monate Zeit, ihre Geschäftspraktiken grundlegend zu überarbeiten. Eine Zäsur, die ihre EU-Operationen fundamental verändern könnte.
KI-Gesetz auf Eis: Innovation vor Regulierung?
Doch Europa rudert an anderer Stelle zurück. Die deutsch-französische Erklärung fordert eine „regulatorische Pause” beim EU-KI-Gesetz – konkret eine 12-monatige Verschiebung der Vorschriften für „Hochrisiko”-KI-Systeme.
Ein überraschender Schritt, der zeigt: Beide Nationen fürchten, dass zu strenge Regeln europäische KI-Champions wie Frankreichs Mistral oder Deutschlands Aleph Alpha im Keim ersticken könnten, bevor sie global wettbewerbsfähig sind.
„Wir brauchen mutige Entscheidungen auf EU-Ebene: ehrgeizige Reformen unserer Digitalisierungs- und KI-Gesetze, einen entschlossenen Bürokratieabbau und viel mehr Raum für Innovation”, betonte Minister Wildberger. Eine Kehrtwende vom bisherigen EU-Ansatz, der Regulierung als Exportschlager verstand.
Marktreaktion: 96 Prozent der Deutschen sind besorgt
Die politischen Manöver spiegeln eine tiefe Besorgnis in der Bevölkerung wider. Eine repräsentative Bitkom-Umfrage vom 17. November zeigt: 96 Prozent der Deutschen sorgen sich um die Abhängigkeit von ausländischen Digitalanbietern.
Noch drastischer: 65 Prozent stufen diese digitale Abhängigkeit als vergleichbar mit militärischen Bedrohungen ein. „Digitale Souveränität ist kein abstraktes Risiko, sondern betrifft Unternehmen, Verwaltung und Gesellschaft direkt”, erklärte Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.
Österreich macht vor: Abschied von Microsoft 365
Die Sorge wird bereits in konkrete Taten umgesetzt. Das österreichische Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft hat kürzlich rund 1.200 Mitarbeiter von Microsoft 365 auf Nextcloud migriert – eine Open-Source-Kollaborationsplattform auf lokaler Infrastruktur.
Das Projekt wurde in nur vier Monaten abgeschlossen und gilt nun als Blaupause für andere europäische Behörden. „Österreich hat gezeigt, dass man mit klugen Zügen viel Kontrolle zurückgewinnen kann – bei minimalen Auswirkungen für die Nutzer”, kommentierte Frank Karlitschek, CEO von Nextcloud.
Ein Erfolg, der die lange vertretene Annahme widerlegt, US-Cloud-Suites seien im öffentlichen Sektor unersetzlich. Doch wie skaliert dieses Modell EU-weit?
Ausblick: Showdown in Brüssel
Die EU-Kommission hat sich 12 Monate Zeit gegeben, um ihre DMA-Ermittlungen gegen AWS und Azure abzuschließen. Die Ergebnisse könnten die bisher größte regulatorische Intervention im Cloud-Markt bedeuten.
Parallel dazu wird die Forderung nach einer KI-Gesetz-Verschiebung intensive Debatten im Europaparlament auslösen. Wird sie gewährt, bekämen europäische KI-Startups ein entscheidendes Zeitfenster, um Produkte mit weniger regulatorischem Ballast zu entwickeln.
Für US-Tech-Riesen ist die Botschaft aus Berlin unmissverständlich: Der europäische Markt ist kein garantierter Selbstläufer mehr, sondern ein umkämpftes Schlachtfeld. Politischer Wille und regulatorische Macht vereinen sich, um Raum für lokale Alternativen zu schaffen. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich 2026 zeigen.
PS: Die Fristen der KI-Verordnung laufen für viele Anbieter schon bald ab — sind Ihre Produkte korrekt klassifiziert? Unser gratis Leitfaden zeigt Schritt für Schritt, wie Sie Ihr KI-System richtig einstufen, Kennzeichnungen anfertigen und die erforderlichen Nachweise bereitstellen. Schnell, praxisnah und ohne juristische Vorkenntnisse. Jetzt Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung sichern